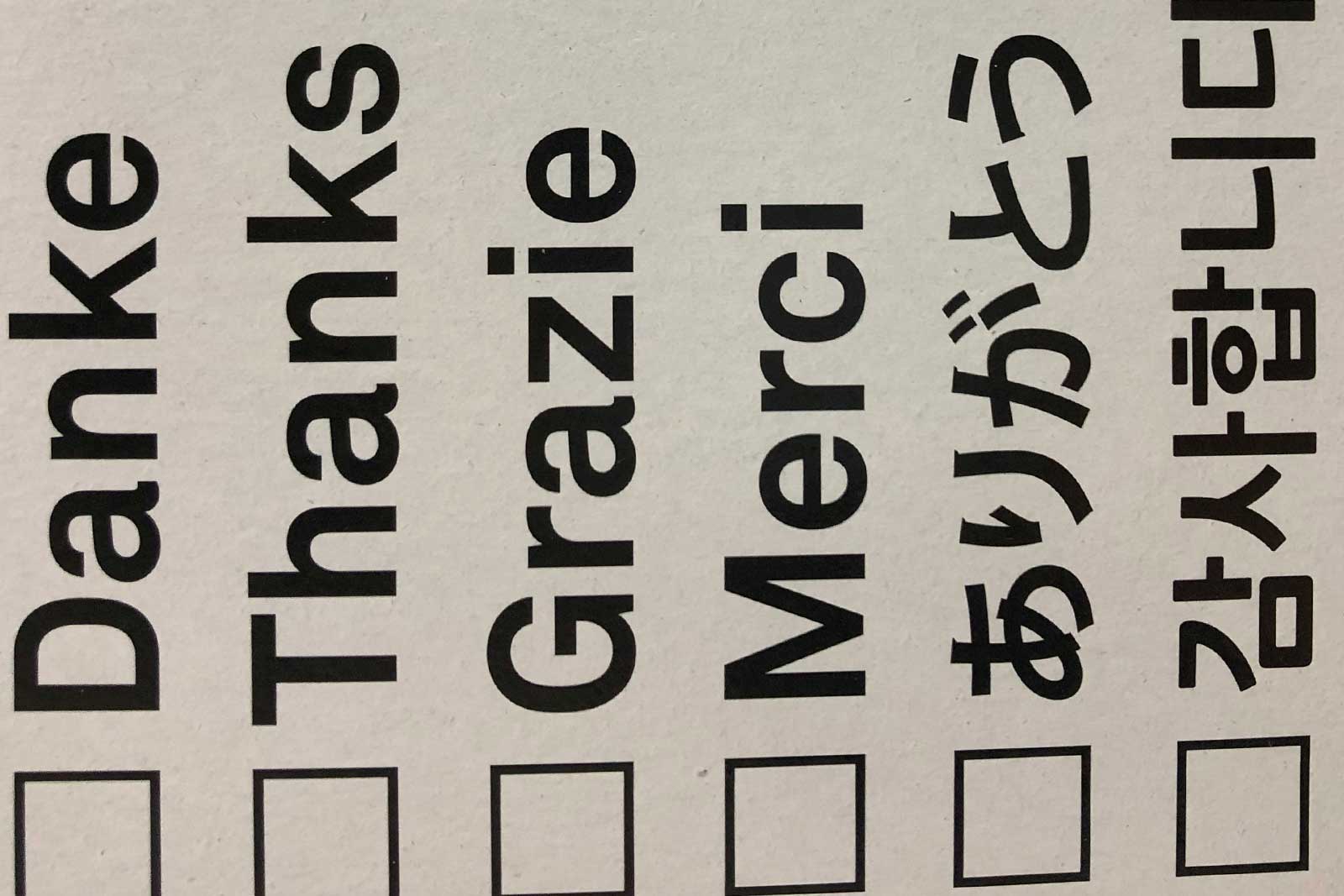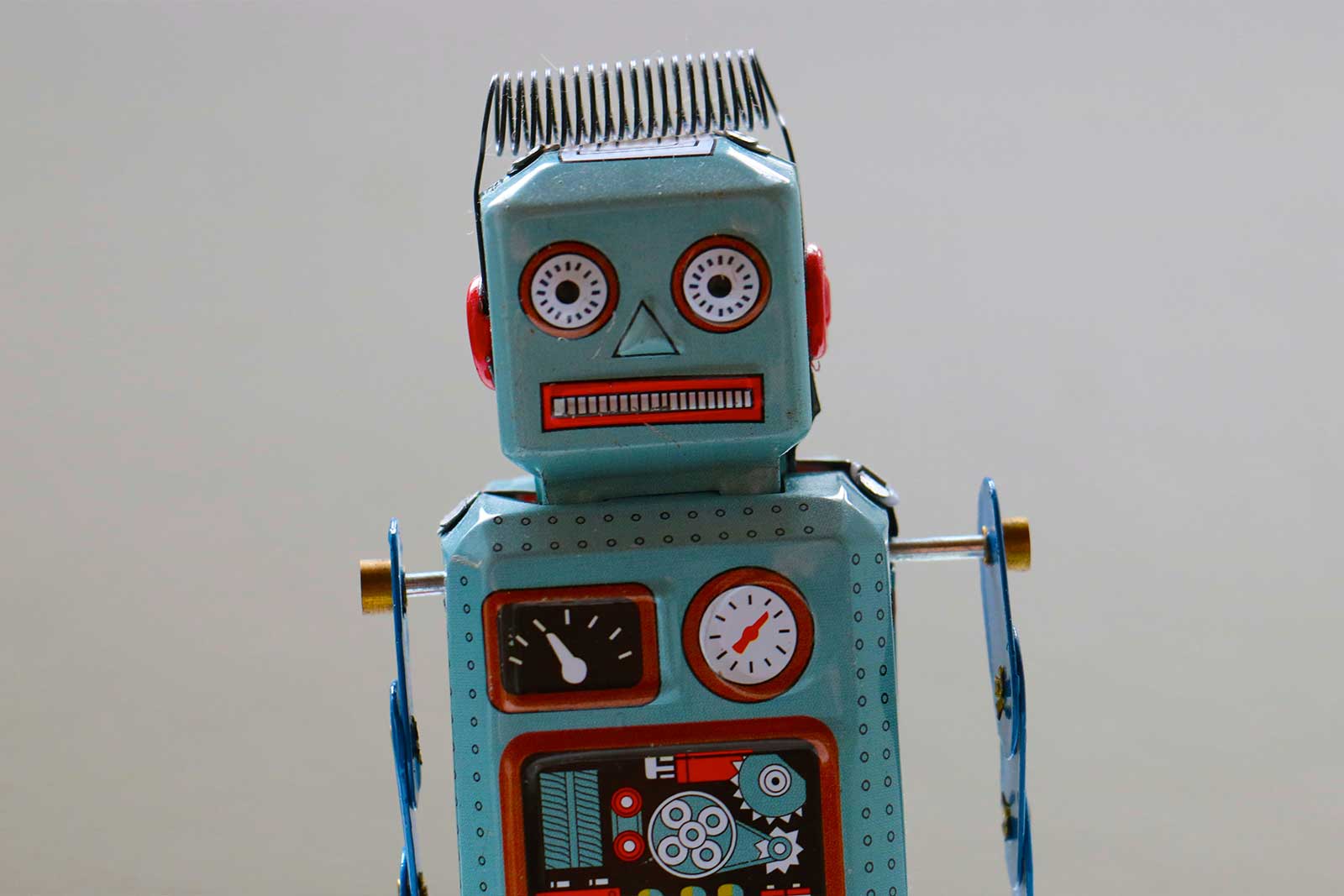Marken, die mehrsprachig funktionieren – in der Schweiz
Drei Landessprachen, drei kulturelle Räume – und eine Marke, die überall funktionieren soll. Wer in der Schweiz Menschen auf Deutsch, Französisch und Italienisch erreichen will, braucht mehr als nur Übersetzungen.
Eine Marke, drei Sprachen: Was die Schweiz besonders macht
Markenbildung ist anspruchsvoll genug – doch in einem mehrsprachigen Land wie der Schweiz kommen zusätzliche Ebenen dazu. Nicht nur weil Texte übersetzt werden müssen, sondern weil jede Sprache ein anderer kultureller Resonanzraum ist. Was im Deutschen sachlich klingt, kann auf Französisch hart wirken. Was auf Italienisch leichtfüssig daherkommt, verliert auf Deutsch an Gewicht. Und umgekehrt.
Für Schweizer Unternehmen, die sich an ein Publikum in mehreren Landesteilen richten, bedeutet das: Markenentwicklung muss mehrdimensional gedacht werden – sprachlich, visuell und kontextuell. Ein Name allein reicht nicht, ein Logo auch nicht. Es geht um die Frage: Wie fühlt sich diese Marke an – in Bern, Lausanne und Bellinzona?
Namen, die funktionieren: zwischen Klang, Bedeutung und Verfügbarkeit
Der Markenname ist oft das erste, was bleibt. Umso wichtiger ist es, dass er nicht nur gut klingt, sondern auch in mehreren Sprachen funktioniert. Dabei geht es nicht allein um Übersetzbarkeit, sondern um Assoziationen, Aussprache, Rhythmus und kulturelle Nebenbedeutungen.
Worauf man beim Namen achten sollte
- Keine negativen oder missverständlichen Bedeutungen in einer Landessprache
- Gleiche oder ähnliche Aussprache in allen Zielregionen – oder bewusst unterschiedlich, aber stimmig
- Keine Abhängigkeit von Wortspielen, die nur in einer Sprache funktionieren
- Domain-Verfügbarkeit und rechtliche Absicherung
- Idealerweise: ein Name, der neutral oder offen genug ist, um sich in mehreren sprachlichen Welten zu verankern
Beispiel: Der Name „Namo“ ist kurz, einprägsam und in keiner Landessprache mit einer negativen Bedeutung verbunden. Er funktioniert sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch und Italienisch – und lässt Raum für Interpretation.
Fallstricke vermeiden
Es gibt bekannte Beispiele, wo internationale Marken in der Schweiz scheitern, weil ein Produktname auf Italienisch etwas Peinliches bedeutet – oder auf Französisch eine ungünstige Konnotation hat. Diese Fehler passieren nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil man den sprachkulturellen Kontext unterschätzt hat.
Eine einfache Testfrage: Würde eine Person in der Westschweiz oder im Tessin den Namen mit demselben Gefühl aussprechen wie jemand in Zürich?
Tonalität, die trägt: zwischen Stil, Rhythmus und Direktheit
Sprache ist nicht nur Information – sie ist Haltung. Und jede Sprache bringt ihre eigene Tonalität mit. Was im Deutschen klar und direkt wirkt, kann im Französischen leicht als unhöflich empfunden werden. Umgekehrt kann französische Eloquenz auf Deutsch schnell „geschwätzig“ wirken, wenn man sie einfach übersetzt.
Wer Marken für mehrere Sprachräume entwickelt, muss sich daher fragen: Was ist der Ton unserer Marke – und wie klingt dieser Ton in jeder Sprache?
Sprachliche Eigenheiten der Landessprachen
- Deutsch: tendenziell sachlich, direkt, präzise. Klarheit wird geschätzt, Ironie seltener.
- Französisch: stilistisch elaborierter, höflicher, mit mehr Fluss und Rhythmus.
- Italienisch: emotionaler, bildreicher, oft persönlicher in der Ansprache.
Es geht nicht darum, den Stil zu nivellieren, sondern darum, in jeder Sprache glaubwürdig zu bleiben – selbst wenn die Tonalität leicht variiert. Einheitlich im Geist, nicht zwingend im Wortlaut.
Logos und Bildsprache: Form über Sprache hinaus
Ein gutes Logo ist sprachunabhängig. Es transportiert eine Idee, ein Gefühl, eine Haltung – visuell, nicht verbal. Trotzdem lohnt es sich, auch hier einen mehrsprachigen Blick zu behalten. Denn Farben, Symbole und Typografie werden je nach Region unterschiedlich gelesen.
Worauf bei Gestaltung zu achten ist
- Keine visuellen Codes, die nur in einer Kultur verankert sind (z. B. Farben mit religiösen oder politischen Konnotationen)
- Typografie, die in allen drei Landessprachen gut lesbar ist – inklusive Akzente und diakritische Zeichen
- Platzierung von Text im Logo: Wenn der Name Teil des Logos ist, sollte er in allen Zielregionen gleich wirken (Stichwort: nicht zu enges Letterspacing, keine verspielten Ligaturen, die z. B. auf Französisch wie ein „œ“ wirken könnten)
Ein professioneller Markenaufbau berücksichtigt, dass Logo, Claim, Farbwelt und Bildsprache nicht nur stimmig, sondern auch interkulturell anschlussfähig sind – ohne dabei beliebig zu werden.
Übersetzen allein reicht nicht: Warum es Adaption braucht
Wer einfach nur von Deutsch auf Französisch oder Italienisch übersetzt, wird rasch an Grenzen stossen. Denn gute Markenkommunikation lebt von Kontext, Rhythmus und Stimmigkeit – und die lassen sich nicht eins zu eins übertragen.
Besser als klassische Übersetzungen sind deshalb Transkreationen: sinngemässe Übertragungen, die denselben Eindruck erzeugen, aber nicht zwingend wörtlich sind.
Beispiel:
- Deutsch: „Wir machen Marken sichtbar.“
- Französisch: „Nous donnons vie à votre marque.“
- Italienisch: „Diamo voce al vostro marchio.“
Alle drei Varianten sagen etwas Ähnliches – aber in der Sprache, die jeweils überzeugt.
Interne Prozesse: Wie man mehrsprachiges Branding organisiert
Mehrsprachige Markenarbeit ist nicht nur eine kreative Aufgabe, sondern auch eine organisatorische. Damit Markenführung über Sprachgrenzen hinweg gelingt, braucht es klare Prozesse und Verantwortlichkeiten:
- Brand-Guidelines, die nicht nur Gestaltung, sondern auch Sprachregeln definieren
- Verantwortliche für Sprachräume, die sensibilisiert sind für kulturelle Nuancen
- Freigabeprozesse, die Übersetzungen nicht nur abnicken, sondern auf Wirkung prüfen
- Ein zentrales Team, das für inhaltliche Kohärenz sorgt – auch wenn Tonalitäten leicht variieren
Diese Struktur verhindert, dass Markenbotschaften verwässern oder widersprüchlich werden.
Zwischen Föderalismus und Markenidentität: Ein Balanceakt
Gerade in der Schweiz ist der Spagat zwischen regionaler Verwurzelung und überregionaler Einheit spürbar. Viele KMU agieren lokal – möchten aber sprachübergreifend auftreten. Der Trick liegt darin, eine Markenidentität zu schaffen, die gross genug ist, um in allen Sprachräumen Platz zu haben – aber konkret genug, um regional glaubwürdig zu bleiben.
Das gelingt, wenn man nicht überall dasselbe sagt, sondern überall das Richtige.
Praxisbeispiel: So könnte ein mehrsprachiger Markenauftritt aussehen
Nehmen wir an, ein Unternehmen bietet Architekturvisualisierungen an. Der Name: „Solaro“. Neutral, leicht aussprechbar, in keiner Sprache negativ konnotiert.
Logo
Reduziert, klar, serifenlose Typo, ein abstrahiertes Hausdach als visuelles Element.
Claim
- Deutsch: Räume sichtbar machen
- Französisch: Rendre l’espace visible
- Italienisch: Dare forma allo spazio
Alle drei Varianten greifen dasselbe Thema auf – jeweils angepasst an Sprachfluss und kulturelle Lesart.
Tone of Voice
- Deutsch: knapp, präzise, leicht technikaffin
- Französisch: flüssiger, mit mehr Betonung auf Form und Ästhetik
- Italienisch: leicht emotionalisiert, bildhafte Sprache
So entsteht ein Markenbild, das zusammengehört, ohne alles gleich zu machen.
Warum sich dieser Aufwand lohnt
Viele Schweizer Unternehmen verschenken Potenzial, weil sie ihre Marke nur aus einer sprachlichen Perspektive entwickeln. Doch wer von Anfang an mehrsprachig denkt, gewinnt nicht nur Reichweite, sondern auch Vertrauen in den Landesteilen.
Eine Marke, die in der Romandie dieselbe Sorgfalt ausstrahlt wie in der Deutschschweiz – und im Tessin nicht wie eine nachträgliche Übersetzung wirkt –, wird als ganzheitlich, professionell und nahbar wahrgenommen.
Und genau das ist es, was Marken heute leisten müssen.
Wenn Sie bei der Entwicklung einer mehrsprachig tragfähigen Markenidentität Unterstützung suchen – ob bei der Namensfindung, der Tonalität oder dem visuellen Aufbau – kann Namo Sie dabei begleiten.